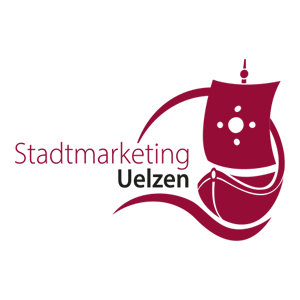Offenes Singen in der St. Marien Kirche
Zu besinnlichen Momenten lädt dieses Jahr wieder die St.-Marien-Kirche zu "Kleinen Konzerten mit Offenem Singen" ein. Vom 1. Advent an (02.12.) finden an jedem Tag von 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr in der St.-Marien-Kirche Uelzen kleine Konzerte statt, bei denen die Besucher auch einige bekannte Advents- und Weihnachtslieder mitsingen können. Es präsentieren sich Chöre und Instrumentalgruppen aus der Region. Der Eintritt ist frei.